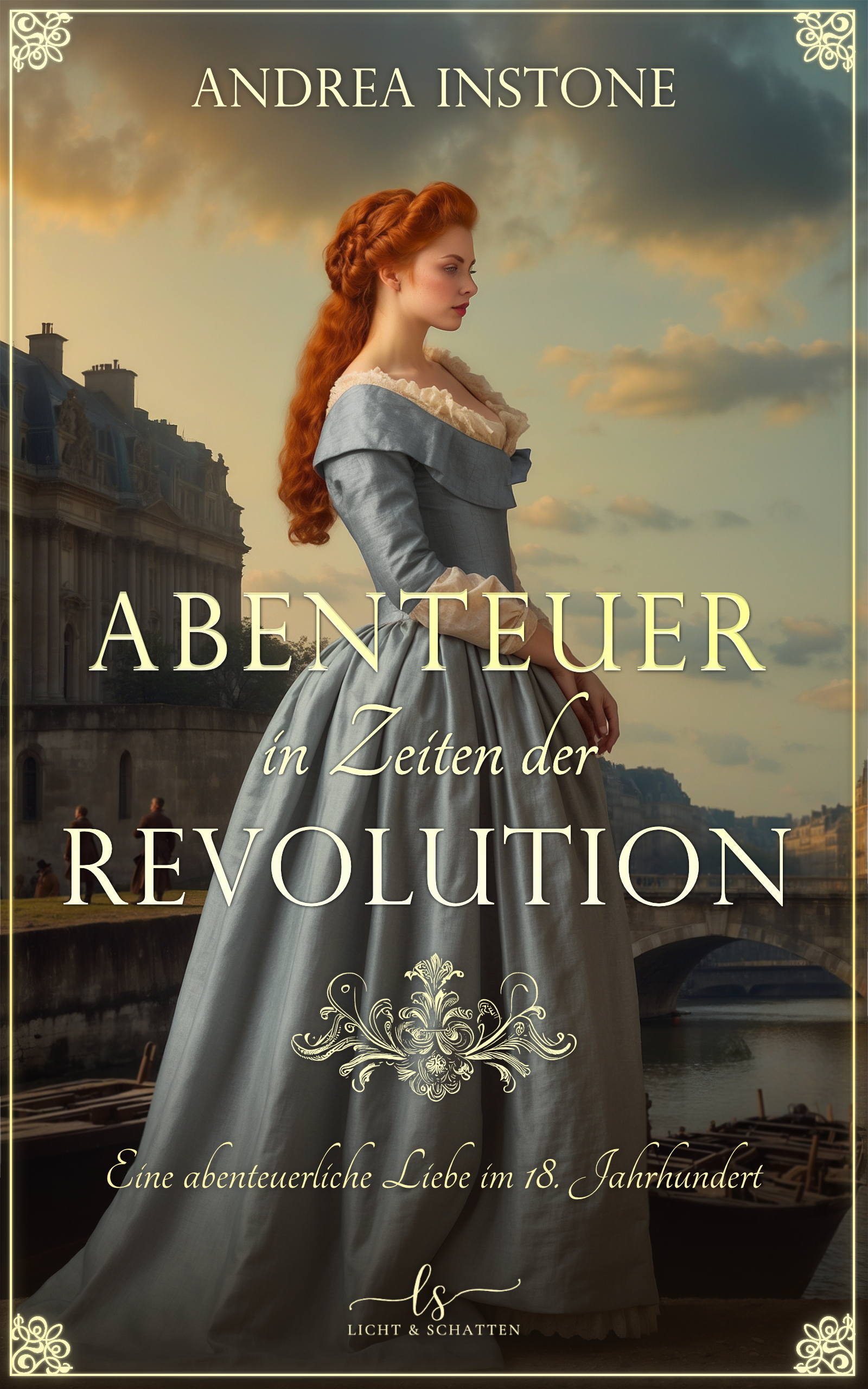
Liebe, Mut und Abenteuer.
Philippe de Beretton hat nur einen Wunsch: Heim zu Luise, heim nach Bonn – und vergessen, was in Paris vor sich geht. Doch genau dorthin muss er – einmal noch in diese Stadt, in der er längst als Feind der neuen Ordnung gilt.
Luise bemüht sich währenddessen um Geduld und Zuversicht. Doch dann erhält sie eine Nachricht, die sie jegliche Vernunft vergessen lässt. Sie muss zu Philippe! Sie muss nach Paris!
In Bonn am Rhein glaubt man sich weit fort von den immer blutiger werdenden Aufständen in Frankreich. Doch vier Tagesreisen sind keine unüberwindbare Entfernung. Nicht für zwei Liebende und ebenso wenig für siegreiche Revolutionstruppen …
Das erste Kapitel
Seit neun Wochen schon wartete Luise de Beretton, geborene Dietz, auf die Rückkehr ihres Ehemanns. Sie wartete vom ersten Tag seiner Abwesenheit bereits ungeduldig und hatte sich angewöhnt, ihm täglich einen Brief zu schreiben, bis Papa begann, ihr die Kosten für Post- und Kurierdienste aufzurechnen. Nicht, dass er kein Verständnis für die junge Liebe habe, meinte er, aber da Philippe doch in Geschäften unterwegs sei, wäre er kaum in der Lage, sämtliche romantischen Ergüsse der Tochter zu lesen.
»Liebelein«, sagte er, »du machst dem armen Kerl nur ein schlechtes Gewissen, weil er deine Güte nicht mit selber Münze zurückzahlen kann. Lass es ruhiger angehen, der Philippe weiß auch so, dass du ihn lieb hast.«
Darauf nickte Luise zwar, gedachte aber nichts an ihrem Vorgehen zu ändern. Ein schlechtes Gewissen sollte Philippe gerne haben, dachte sie im Stillen. Immerhin hätte er doch bei ihr bleiben sollen. Hätte es sogar müssen. Ja ja, Ehrenwort, Pflicht und Treue, das war schön und gut, aber was war mit ihr. Und was war mit Madeleine du Jobert
? Nein, Philippe musste täglich einen Gruß erhalten, musste täglich lesen, wie sehr sie ihn liebte, vermisste und herbeisehnte. Obwohl sie genau wusste, wie töricht ihr Verhalten war.
Sie seufzte so laut, dass Papa Dietz sie kritisch beäugte. »Mein liebes Kind, willst du mir nicht sagen, was dich bewegt? Sicherlich ist es nicht schön, so lange getrennt zu sein, doch wenn ich ehrlich sein darf, scheint mir dein Verhalten etwas exaltiert. Dein ständiges Schreiben hat etwas geradezu Besessenes.«
Vaters Bemerkung traf so sehr mit ihrer eigenen Erkenntnis zusammen, dass Luise sich zusammenriss und nicht mehr täglich schrieb. Sie suchte nach Ablenkung, doch nicht einmal die Feierlichkeiten zum dreiunddreißigsten Geburtstag des Kurfürsten vermochten sie länger als ein oder zwei Stunden zu amüsieren. Alles lief an ihr vorüber, an nichts hatte sie aufrichtige Freude. Wie auch? Sie fühlte sich einsamer als jemals, sie fürchtete um Leib und Leben ihres Mannes und verging vor Eifersucht. Eifersucht, zu der sie kaum Grund haben dürfte. Luise wusste, sie war unvernünftig; sie benahm sich wie ein verwöhntes Gör, dem man einen nicht zu erfüllenden Wunsch verweigert hatte. So wollte sie nicht sein, also arbeitete sie hart an sich. Und an ihren Rollen. Das lohnte, denn sie brillierte auf der Bühne in einer neuen Oper, in der sie zwar nur einen kleinen Part hatte, diesen aber so gut ausfüllte, dass das Publikum mitten in der Szene applaudierte. Das verschaffte ihr neuen Mut und täglich sagte sie sich, dass nichts Schlimmes zu befürchten war und Philippe sie so sehr liebe, wie auch sie für ihn fühlte.
Genau dasselbe sagten auch die Freundinnen. Denen hatte sie anvertraut, in welcher Sorge sie lebte. Nun ja, sie hatte es ihnen weitestgehend gesagt; sie konnte auch ihnen nicht offenbaren, in wessen Auftrag Philippe unterwegs war. Aber eine Weile nach dem Gespräch mit Papa – es war Mitte Dezember – erzählte sie ihnen dann doch, dass nicht nur Philippe in Wien sei, sondern ebenso Madame und Mademoiselle du Jobert.
Mehr hatte sie nicht sagen müssen, da stieß Babette schon einen empörten Schrei aus und Lorchen griff nach ihrer Hand. Nur Amalie schaute mit gerunzelter Stirn ratlos um sich, bis Babette sie aufklärte.
»Sei kein Schaf! Erinnerst du dich nicht, wie diese Madeleine immerzu Philippes Aufmerksamkeit suchte?«
»Hat sie das? Davon habe ich nichts bemerkt.«
»Dann bist du doch ein Schaf. Das muss ja eine Freude für deinen Grub sein, wenn du in allem so hinterm Berg bist.«
»Hinterm Berg? Das bin ich gewiss nicht. Ich verstehe auch nicht, was diese Madeleine mit meinem Ludwig zu tun haben soll.«
Babette schnaubte und überließ es Lorchen, Amalie zu erklären, um was es ging; die brachte das wesentlich feiner und mitfühlender über die Lippen.
»Sieh, Luise befürchtet, es könnte Madeleine du Jobert in der einzigen Absicht nach Wien gereist sein, um sich an Philippe heranzumachen. Und wenn du diese Sorge nicht begreifen kannst und nicht sehen konntest, wie sie ihm immerzu gefallen wollte, dann möchte es sein, du bemerkst derlei auch nicht, wenn eine andere deinem Ludwig schöne Augen macht.«
Luise, die ganz froh war, nicht länger im Mittelpunkt zu stehen, wagte sich nun als Erste, die Frage zu stellen, die bislang keine zu stellen gewagt hatte. Amalie war zwar seit zehn Tagen nicht länger die Demoisell von Mastiaux, sondern die Hofrätin Amalie von Grub, hatte aber bislang nichts über ihre junge Ehe zum Besten gegeben. Nach wie vor kam sie zu jedem Treffen der Freundinnen, verbrachte die meiste Zeit im Hause des Vaters – aus dem sie doch unbedingt hatte hinaus wollen – und benahm sich nicht ein bisschen anders als zuvor.
»Wie ist es denn daheim?«, fragte Luise also, während Lorchen und Babette näher heranrückten und Amalie erwartungsvoll anblickten.
»Oh, Vater geht es so weit recht gut, wenn er auch immer wieder sagt, er fühle sein Ende nahen. Die Brüder -«
»Schaf!«, entfuhr es Babette. »Wir wollen wissen, wie es mit deinem Grub ist.«
»Wie es so ist unter Eheleuten, da ist nichts Besonderes zu berichten.« Sonderlich interessiert klang Amalie nicht.
»Oh ja, damit können wir natürlich viel anfangen. Was wissen wir schon davon, wie es unter Eheleuten ist? Luise wird wohl nicht als Beispiel für alle gelten können. Oder doch? Ist dein Grub ebenso zärtlich und leidenschaftlich wie Philippe?«
Luise versetzte der Freundin einen Schubs. »Wann hätte ich je behauptet, Philippe wäre zärtlich und leidenschaftlich?«
»Ist er es nicht? Wirklich, ihr zwei seid uns schlechte Freundinnen, wenn ihr euch so ausschweigt. Sieh uns an, Lorchen, wir sehen frisch aus und adrett, wir sind bester Laune und zu allen Scherzen aufgelegt, aber diese da ziehen Gesichter wie drei Tage Regenwetter und wollen nichts verraten. Eine Werbung fürs Heiraten sind sie nicht.«
Während Luise augenblicklich lachend widersprach, zuckte Amalie die Schultern. Nachlässig spielte sie mit dem Schleifenband ihres wollenen Umhangs, der im Übrigen von einer so hervorragenden Qualität war, dass die Freundinnen seinen Stoff wieder und wieder streichelten.
Auf dieses edle Kleidungsstück wies Eleonore nun. »Ein Geschenk deines Gemahls, nehme ich an? Er muss wohl sehr glücklich mit dir sein, um so viele Taler auszugeben.«
»Ich habe keine Ahnung, was es gekostet hat, das interessiert mich auch nicht. Derlei ist Aufgabe des Mannes.«
»Aber es ist Ludwigs Gabe an dich?«
Wieder zuckte Amalie die Schultern. »Er bringt mir alle Abende etwas mit.«
»Und du dankst es ihm mit Küssen?«, fragte Babette.
Amalie zeigte eine so angewiderte Miene, dass die Freundinnen erschraken.
»Was ist denn nur mit dir?«, wollte Lorchen wissen. »Ist es dir so unangenehm, mit uns darüber zu sprechen, oder
?«
»Oder was?« Schneidend kam die Gegenfrage.
Babette musterte Amalie kurz. »Nicht die Frage ist ihr unangenehm, sondern Grubs Küsse. Oder schlimmer noch? Ist es der ganze Mann?«
Mit einem Satz war Amalie auf den Füßen und blitzte die Freundinnen an. »Was ihr euch herausnehmt! Ich bin nicht einmal zwei Wochen vermählt und ihr bedrängt mich mit unverschämten Fragen und gemeinen Unterstellungen! Ich könnte mich nicht erinnern, dass ihr euch Luise gegenüber ähnlich betragen hättet! Kümmert euch lieber um sie und darum, weshalb ihr Beretton so lange fortbleibt und sie sich sorgt, es könnte irgendein anderes Weib etwas von ihm wollen. Ganz offenbar zweifelt sie nun bereits an seiner Treue zu ihr, vielleicht gar an seiner Liebe. Und -«
»Das tue ich nicht! Ich -«
»Und ich muss schon sagen: Was ist denn das für eine Ehe, wenn der eine nach fünf Tagen bereits das Weite sucht und monatelang in Geschäften herumstromert?«
»Philippe und Papa -« Luise kam nicht weit.
Amalie war in Fahrt, ihr Temperament hatte die Zügel in die Hand genommen und wütender, rücksichtsloser, als man sie sonst kannte, fuhr sie fort. »Ach, komme mir nicht mit deinem Vater und seinen Geschäften! Deine Brüder sind kaum jemals länger als eine Woche unterwegs gewesen und die arbeiten doch immerhin in den Läden. Dein Franzose aber – der hat damit doch gar nichts zu tun! Fünf Wochen, ich bitte euch! Fünf Wochen in Wien und ist doch noch nicht auf dem Weg heim? Was tut er dort? Alles aufkaufen, was zu finden ist? Bringt er uns jede Geige und jedes Buch heim und was immer dort zu finden sein mag? Nein, es liegt auf der Hand, weshalb Luise so unglücklich ist!«
»Aber ich bin nicht unglücklich und Philippe würde niemals mit Madeleine
oder einer anderen
nein, das täte er nicht und das denke ich auch nicht und ich bin
ach, was rede ich überhaupt mit dir! Es ist ja ganz offenbar, was du versuchst! Du willst ablenken von deiner Ehe und -«
Amalie war herumgefahren, baute sich dicht vor Luise auf und schaute sie fest an. Gar nicht einmal wütend, sondern eher bittend. Verzweifelt und bittend. Luise glaubte, zu verstehen, was in ihr vorging; sie erinnerte sich eines Gesprächs, das sie vor nun bald einem halben Jahr geführt haben mussten. Nach kurzem Zögern lachte sie. Es war hilfreich, dass sich ihr schauspielerisches Talent durch das eine Jahr Bühnenerfahrung verfeinert hatte; sie verstand es besser und selbstverständlicher zu nutzen.
»Himmel noch, liebste Amalie, jetzt haben wir unseren Freundinnen so richtig Angst vorm Ehestand eingejagt. Du hast ja völlig recht, man muss sich erst gewöhnen und eure Fragen, beste Babette, liebliche Lore, sind wohl verständlich, aber doch zu früh, zu zudringlich. Und ja, drei Mal ja, ich sorge mich, dass diese dumme Pute von Madeleine um Philippe herum sein könnte. An seiner Liebe zweifele ich nicht, auch nicht an seiner Treue. Nur
«
»Nur was?«
Noch immer mochte Luise nicht zugeben, wie sehr sie doch einen Sieg Madeleines fürchtete, aber als Amalies Hand unauffällig die ihre suchte und dankbar drückte, da opferte sie sich dann doch. »Ein starker Wein, ein schwacher Moment, seine Sehnsucht nach mir
es könnte ihr doch gelingen
«
Die Freundinnen beruhigten sie, versicherten ihr, es gäbe für Philippe niemals eine andere, das wäre offensichtlich, daran könne man nicht zweifeln. Luise wollte das gerne glauben und zeigte sich bald überzeugt. Nun wollte sie das Treffen zu einem raschen Ende bringen und alleine mit Amalie sprechen; die schien ihr die größeren Sorgen zu haben.

